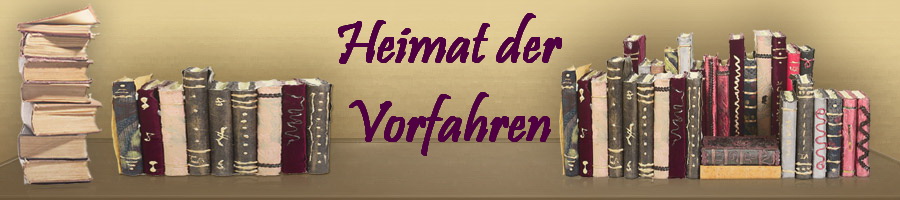ohne weitere Worte....kann jeder wortgetreu auf der HP der Angerburger so nachlesen....
Das Absterben des Masurischen
Aus dem Buch „Alte und neue Bilder aus Masuren, Eine Geschichte der Stadt und des Kreises Angerburg“ 1888/1925 von Superintendent Hermann Braun.
Das Masurische ist eine Abart des Polnischen, aber weit wohlklingender als dieses. Es hat nicht die unnatürliche Häufung der Zischlaute und die Nachäffung des Französischen in den Nasentönen wie das Polnische. Ich erlernte leider zuerst das Hochpolnische als Kandidat aus Büchern, nicht aus Liebe zur Sprache, sondern um bald eine Pfarrstelle in Masuren erlangen zu können. Es waren damals so viele Theologen, dass, wer nicht polnisch oder litauisch konnte, alt und grau wurde, bis er eine Pfarrstelle bekam. Als ich Pfarrer in Lötzen (1872-80) wurde, konnte ich zwar polnisch predigen, aber die Unterhaltung mit den masurisch redenden Gemeindegliedern führte zu manchem Missverständnis. Es gab damals in der Lötzener Landgemeinde noch viele Leute, die kein deutsches Wort reden konnten. Eine solche Frau kam zu mir und klagte unter Tränen schreckliche Dinge von ihrem chlop (ohne polnische Lautzeichen) er wolle nicht robic (arbeiten), nur immer szympowac (schimpfen), kurz ihr chlop sei nic Dobrego (nichts Gutes). Ich, der pan dobrodzya (Herr Wohltäter – so reden die Masuren ihren Pfarrer an) möchte ihr doch dobro rade dac (guten Rat geben). Mit gespannter Aufmerksamkeit höre ich zu, damit ich alles wohl verstehen möge, denn ihre Rede ergoß sich wie ein Wasserfall über mich. Nachdem ich die Schandtaten ihres chlop wohlverstanden hatte, auch mich erinnerte die Vokabel chlop in der Grammatik mit „Junge“ übersetzt gefunden zu haben, gab ich ihr meinen seelsorgerischen Rat.
„Kijem, Kijem!“ (mit dem Stock, mit dem Stock!) Einziges Heilmittel für verwahrloste Jungen! Dabei zeigte ich, wie sie ihn über den Stuhl legen und verdreschen solle. Sie meinte, der chlop sei zu stark. Ich meinte, sie sei doch auch eine recht starke Frau, die ihren chlop zwingen werde; sie möchte ihm sagen, dass ich es befohlen habe und mich beim nächsten Gebetverhör im Dorf nach seiner Besserung erkundigen würde. Da trocknete die Frau ihre Tränen, dankte für den guten Rat und ging fort. Das alles hatte meine Frau im Nebenzimmer gehört; sie konnte nämlich durch das Gesinde im Elternhause das Polnische besser wie ich aus Büchern. Nun kam sie lachend ins Amtszimmer: „ Was hast du nur gesagt? Die Frau soll ihren Mann über den Stuhl legen und ihm Hiebe geben? – „Nein, sagte ich, die Frau klagte über ihren chlop und das heißt doch Jung ! Mag ein Bengel von 10 – 12 Jahren sein“. „Aber du hast chlop – Mann mit chlopiec – Jung verwechselt,“ sagt sie. Sie hatte recht. Da hatte ich was schönes angestiftet: eine regelrechte Prügelei zwischen Mann und Frau! Aber mein Irrtum brachte doch gesegnete Früchte. Als die Frau ihrem Mann erzählte, was der neue Pfarrer gesagt und über die Sache beim nächsten Gebetsverhör im Dorf, also vor der ganzen Gemeinde, verhandeln würde, wurde er doch kleinlaut, und meinte Coz czynic? Was ist da zu machen? – Glückstrahlend teilte mir die Frau seine Besserung mit.
Ein Bauer vom Lande bei Lötzen fragte meine Frau im Hausflur: „ Wohnt sich hier das junge Pfaff?“ Da öffnet meine Frau das Amtszimmer und stellt lachend vor: „Das hier ist das junge Pfaff“ – da lachten wir drei, nur das masurische Bäuerlein wusste nicht, weshalb. – Er verstand kein deutsches Wort außer dem Satz, den ihm jemand zum Scherz beigebracht haben mochte. –
Als ich vor 45 Jahren (1880) nach Angerburg versetzt wurde, hörte man an den Markttagen überall auf den Straßen und an den Verkaufsständen noch polnische Laute. Die Landfrauen hatten in ihren Körben nicht Butter und Eier, sondern pomaska und jaike. Die städtischen Frauen fragten die Verkäuferinnen nicht, was kostet es? Sondern co Kustuje? Die Antwort war: pomaska kustuje siedm trojaki. (Butter kostet 7 Silbergroschen), jaike jeden trojak za pientsch (Eier 1 Silbergroschen für 5). Die gensch (Gans) trzy zloty (drei Gulden), die ryby (Fische) das Pfund jeden trojak Silbergroschen). Die städtischen Hausfrauen, die nicht polnisch verstanden, taten wohl daran, die sich zum Handel nötigen Vokabeln der polnischen Sprache anzueignen, um billiger einzukaufen. Die Landfrauen hielten eine nur deutsch redende Frau für vornehm und reich, die auch das Doppelte zahlen könne.
In vielen Familien auf dem Lande wurde nur polnisch gesprochen. Erst in der Schule lernten die Kinder deutsch. Aber auch ganz verdeutschte Gegenden hielten an einigen polnischen Worten fest z. B. Kur Hahn, Koza Ziege. Schulrat Snoy in Gumbinnen holte aus dem riesigen Sack voll heiterer Geschichten, den er besaß, auch diese hervor: „Bei einer Schulrevision sah ich vor der Schule eine Ziege weiden und fragte die Kinder: Was ist das für ein Tier, das ihr draußen seht? Alle hoben die Hand auf. Jetzt sprecht alle im Chor: „Das ist –“. Die ganze Schule sprach im Chor: „Das ist eine Kos“ – „Kinder, ihr habt falsch gesehen. Ein Tier das Kos heißt, kenne ich nicht“. – Da kam der Lehrer selbst ans Fenster und sagte: „Herr Schulrat, es ist wirklich eine Kos“ – Das „Kosa schiwa, Kosa schiwa“ d.h. graue Ziege, graue Ziege – ist ein masurisches Volkslied, in welchem die Schönheiten und Künste der grauen Ziege besungen werden. Zugleich ist Kosa schiwa der masurische Nationaltanz, der nach der Melodie dieses Liedes getanzt wird. …
… Wenn ich in Doben, wo sich das Masurische am hartnäckigsten hielt, weil dort die Instfamilien seit Jahrhunderten sesshaft blieben, die Schulkinder deutsch prüfte, bekam ich schwerlich eine Antwort heraus. Es war so, als wenn man zu den Sextanern eines Gymnasiums lateinisch sprach. Sobald ich aber auf Masurisch sie fragte, entstand große Heiterkeit und Lebendigkeit. Die stumpfen Mienen verschwanden plötzlich. Daß ein Herr zu ihnen die Sprache des Vaters und der Mutter redete, war ihnen etwas Neues. Sie antworteten frisch und fröhlich, sie wagten jetzt auch deutsch zu sprechen, wie sie es in der Schule gelernt hatten.
Przyborowski war das Urbild eines bedürfnislosen Naturmenschen. Selbst der alte Tonnenbewohner Diogenes hätte vor ihm den Hut abgenommen, seine Laterne ausgelöscht und gesagt: Endlich habe ich einen Menschen gefunden. Przyborowski übertraf den Diagones in vielen Stücken. Dieser musste sich sein Haus, die Tonne, erst von einem Böttcher kaufen und Geld zahlen, aber unser Przyborowski baute selbst sich für den Sommer eine Bude von Reisig in der Nähe der Angerapp. Im Winter begnügte er sich mit einem Lager von trockenen Blättern, die er im Herbst auf den Kirchenberg gesammelt und auf dem Boden eines Bürgerhauses ausgebreitet hatte. Diogenes konnte sich von süßen Feigen nähren, die in Massen überall an den Straßen wuchsen. – Przyborowski begnügte sich mit einem Stück trocknen Schwarzbrots und trank Wasser dazu; nu am Sonntag aß er Pellkartoffeln, die er selbst gekocht. Diagones war ein Schwätzer und frech dazu, sodaß er sogar Alexander dem Großen befahl, ihm aus der Sonne zu gehen. Przyborowski war still und bescheiden, so dass er wochenlang kein Wort sprach, nur dann und wann freundlich lächelte. Diagones war ein Faultier und sonnte sich den ganzen Tag. Przyborowski arbeitete fleißig, und weil er seinen Lohn nicht verbrauchte, teilte er davon gutherzig andern mit. – Er besaß nur einen einzigen, uralten Wamsrock für Sommer und Winter, umgürtet mit einem Strick, ein einziges Hemd, das nicht mehr schneeweiß sein konnte. Er tat dem Frauenverein sehr leid, der ihn mit neuen Hemden und Kleidern beschenkte, aber Przyborowski nahm das Geschenk nicht an. Wie er seinen Leib, so hatte er auch sein uraltes Gesangbuch, das aus losen Blättern bestand, mit einem Strick umgürtelt. Das neue Gesangbuch, das ich ihm schenken wollte, lehnte er dankend ab. Er versäumte keinen masurischen Gottesdienst. Äußerlich ein wilder Bär, innerlich ein sanftes Lamm.
Die alte Skerra aus dem Armenhaus in Prinowen war der krasse Gegensatz von Przyborowski. Ihre Kleidung war sauber, ihr Antlitz voll Sonnenschein, ihre Augen strahlend von Glück und Zufriedenheit. Weder Frost noch Hitze, weder Sturm noch Regen konnte sie hindern, unser Gotteshaus zu besuchen. Sonntäglich wanderte das gekrümmte Mütterchen am Stabe, den weiten Weg von acht Kilometer zur Kirche, nahm teil am deutschen Gottesdienst und blieb zum polnischen, wenn ein solcher war, erinnernd an jene alte Hanna zu Jerusalem. Nur ein einziges Mal konnte sie nicht kommen: das war der Sonntag, an dem sie starb.
Den Platz des absterbenden Masurisch eroberte sich im Volk schnell das Plattdeutsch. Das Hochdeutsche konnte nicht Schritt halten. In der Schule freilich lernten die polnischen Kinder hochdeutsch sprechen, aber die Eltern und älteren Geschwister zogen den plattdeutschen Dialekt vor, den sie durch den Umgang mit plattdeutsch Redenden lernten. Das Plattdeutsch läuft viel glatter von der Zunge und verkürzt die Worte: z.B. Ons Vadder = unser Vater; ons ni Lehra = unser neue Lehrer. Es macht keinen Unterschied zwischen Dativ und Accusativ, liebt den Dativ “dem“ für beide Geschlechter und alle Kasus und setzt in zweifelnden Fällen, ob männlich oder weiblich, das sächliche Geschlecht: z. B. Öck häw dem Kau vom Unkel gekofft, dat Kau göft däglich tien Stop Melk. Dem Schmand schepp öck af on maak Botter. Dem Botter verköp öck for näge Dittke dat Pund on köp daför enen Dook för de Dochter.
Gefunden auf der HP angerburg.de
Das Absterben des Masurischen
Aus dem Buch „Alte und neue Bilder aus Masuren, Eine Geschichte der Stadt und des Kreises Angerburg“ 1888/1925 von Superintendent Hermann Braun.
Das Masurische ist eine Abart des Polnischen, aber weit wohlklingender als dieses. Es hat nicht die unnatürliche Häufung der Zischlaute und die Nachäffung des Französischen in den Nasentönen wie das Polnische. Ich erlernte leider zuerst das Hochpolnische als Kandidat aus Büchern, nicht aus Liebe zur Sprache, sondern um bald eine Pfarrstelle in Masuren erlangen zu können. Es waren damals so viele Theologen, dass, wer nicht polnisch oder litauisch konnte, alt und grau wurde, bis er eine Pfarrstelle bekam. Als ich Pfarrer in Lötzen (1872-80) wurde, konnte ich zwar polnisch predigen, aber die Unterhaltung mit den masurisch redenden Gemeindegliedern führte zu manchem Missverständnis. Es gab damals in der Lötzener Landgemeinde noch viele Leute, die kein deutsches Wort reden konnten. Eine solche Frau kam zu mir und klagte unter Tränen schreckliche Dinge von ihrem chlop (ohne polnische Lautzeichen) er wolle nicht robic (arbeiten), nur immer szympowac (schimpfen), kurz ihr chlop sei nic Dobrego (nichts Gutes). Ich, der pan dobrodzya (Herr Wohltäter – so reden die Masuren ihren Pfarrer an) möchte ihr doch dobro rade dac (guten Rat geben). Mit gespannter Aufmerksamkeit höre ich zu, damit ich alles wohl verstehen möge, denn ihre Rede ergoß sich wie ein Wasserfall über mich. Nachdem ich die Schandtaten ihres chlop wohlverstanden hatte, auch mich erinnerte die Vokabel chlop in der Grammatik mit „Junge“ übersetzt gefunden zu haben, gab ich ihr meinen seelsorgerischen Rat.
„Kijem, Kijem!“ (mit dem Stock, mit dem Stock!) Einziges Heilmittel für verwahrloste Jungen! Dabei zeigte ich, wie sie ihn über den Stuhl legen und verdreschen solle. Sie meinte, der chlop sei zu stark. Ich meinte, sie sei doch auch eine recht starke Frau, die ihren chlop zwingen werde; sie möchte ihm sagen, dass ich es befohlen habe und mich beim nächsten Gebetverhör im Dorf nach seiner Besserung erkundigen würde. Da trocknete die Frau ihre Tränen, dankte für den guten Rat und ging fort. Das alles hatte meine Frau im Nebenzimmer gehört; sie konnte nämlich durch das Gesinde im Elternhause das Polnische besser wie ich aus Büchern. Nun kam sie lachend ins Amtszimmer: „ Was hast du nur gesagt? Die Frau soll ihren Mann über den Stuhl legen und ihm Hiebe geben? – „Nein, sagte ich, die Frau klagte über ihren chlop und das heißt doch Jung ! Mag ein Bengel von 10 – 12 Jahren sein“. „Aber du hast chlop – Mann mit chlopiec – Jung verwechselt,“ sagt sie. Sie hatte recht. Da hatte ich was schönes angestiftet: eine regelrechte Prügelei zwischen Mann und Frau! Aber mein Irrtum brachte doch gesegnete Früchte. Als die Frau ihrem Mann erzählte, was der neue Pfarrer gesagt und über die Sache beim nächsten Gebetsverhör im Dorf, also vor der ganzen Gemeinde, verhandeln würde, wurde er doch kleinlaut, und meinte Coz czynic? Was ist da zu machen? – Glückstrahlend teilte mir die Frau seine Besserung mit.
Ein Bauer vom Lande bei Lötzen fragte meine Frau im Hausflur: „ Wohnt sich hier das junge Pfaff?“ Da öffnet meine Frau das Amtszimmer und stellt lachend vor: „Das hier ist das junge Pfaff“ – da lachten wir drei, nur das masurische Bäuerlein wusste nicht, weshalb. – Er verstand kein deutsches Wort außer dem Satz, den ihm jemand zum Scherz beigebracht haben mochte. –
Als ich vor 45 Jahren (1880) nach Angerburg versetzt wurde, hörte man an den Markttagen überall auf den Straßen und an den Verkaufsständen noch polnische Laute. Die Landfrauen hatten in ihren Körben nicht Butter und Eier, sondern pomaska und jaike. Die städtischen Frauen fragten die Verkäuferinnen nicht, was kostet es? Sondern co Kustuje? Die Antwort war: pomaska kustuje siedm trojaki. (Butter kostet 7 Silbergroschen), jaike jeden trojak za pientsch (Eier 1 Silbergroschen für 5). Die gensch (Gans) trzy zloty (drei Gulden), die ryby (Fische) das Pfund jeden trojak Silbergroschen). Die städtischen Hausfrauen, die nicht polnisch verstanden, taten wohl daran, die sich zum Handel nötigen Vokabeln der polnischen Sprache anzueignen, um billiger einzukaufen. Die Landfrauen hielten eine nur deutsch redende Frau für vornehm und reich, die auch das Doppelte zahlen könne.
In vielen Familien auf dem Lande wurde nur polnisch gesprochen. Erst in der Schule lernten die Kinder deutsch. Aber auch ganz verdeutschte Gegenden hielten an einigen polnischen Worten fest z. B. Kur Hahn, Koza Ziege. Schulrat Snoy in Gumbinnen holte aus dem riesigen Sack voll heiterer Geschichten, den er besaß, auch diese hervor: „Bei einer Schulrevision sah ich vor der Schule eine Ziege weiden und fragte die Kinder: Was ist das für ein Tier, das ihr draußen seht? Alle hoben die Hand auf. Jetzt sprecht alle im Chor: „Das ist –“. Die ganze Schule sprach im Chor: „Das ist eine Kos“ – „Kinder, ihr habt falsch gesehen. Ein Tier das Kos heißt, kenne ich nicht“. – Da kam der Lehrer selbst ans Fenster und sagte: „Herr Schulrat, es ist wirklich eine Kos“ – Das „Kosa schiwa, Kosa schiwa“ d.h. graue Ziege, graue Ziege – ist ein masurisches Volkslied, in welchem die Schönheiten und Künste der grauen Ziege besungen werden. Zugleich ist Kosa schiwa der masurische Nationaltanz, der nach der Melodie dieses Liedes getanzt wird. …
… Wenn ich in Doben, wo sich das Masurische am hartnäckigsten hielt, weil dort die Instfamilien seit Jahrhunderten sesshaft blieben, die Schulkinder deutsch prüfte, bekam ich schwerlich eine Antwort heraus. Es war so, als wenn man zu den Sextanern eines Gymnasiums lateinisch sprach. Sobald ich aber auf Masurisch sie fragte, entstand große Heiterkeit und Lebendigkeit. Die stumpfen Mienen verschwanden plötzlich. Daß ein Herr zu ihnen die Sprache des Vaters und der Mutter redete, war ihnen etwas Neues. Sie antworteten frisch und fröhlich, sie wagten jetzt auch deutsch zu sprechen, wie sie es in der Schule gelernt hatten.
Przyborowski war das Urbild eines bedürfnislosen Naturmenschen. Selbst der alte Tonnenbewohner Diogenes hätte vor ihm den Hut abgenommen, seine Laterne ausgelöscht und gesagt: Endlich habe ich einen Menschen gefunden. Przyborowski übertraf den Diagones in vielen Stücken. Dieser musste sich sein Haus, die Tonne, erst von einem Böttcher kaufen und Geld zahlen, aber unser Przyborowski baute selbst sich für den Sommer eine Bude von Reisig in der Nähe der Angerapp. Im Winter begnügte er sich mit einem Lager von trockenen Blättern, die er im Herbst auf den Kirchenberg gesammelt und auf dem Boden eines Bürgerhauses ausgebreitet hatte. Diogenes konnte sich von süßen Feigen nähren, die in Massen überall an den Straßen wuchsen. – Przyborowski begnügte sich mit einem Stück trocknen Schwarzbrots und trank Wasser dazu; nu am Sonntag aß er Pellkartoffeln, die er selbst gekocht. Diagones war ein Schwätzer und frech dazu, sodaß er sogar Alexander dem Großen befahl, ihm aus der Sonne zu gehen. Przyborowski war still und bescheiden, so dass er wochenlang kein Wort sprach, nur dann und wann freundlich lächelte. Diagones war ein Faultier und sonnte sich den ganzen Tag. Przyborowski arbeitete fleißig, und weil er seinen Lohn nicht verbrauchte, teilte er davon gutherzig andern mit. – Er besaß nur einen einzigen, uralten Wamsrock für Sommer und Winter, umgürtet mit einem Strick, ein einziges Hemd, das nicht mehr schneeweiß sein konnte. Er tat dem Frauenverein sehr leid, der ihn mit neuen Hemden und Kleidern beschenkte, aber Przyborowski nahm das Geschenk nicht an. Wie er seinen Leib, so hatte er auch sein uraltes Gesangbuch, das aus losen Blättern bestand, mit einem Strick umgürtelt. Das neue Gesangbuch, das ich ihm schenken wollte, lehnte er dankend ab. Er versäumte keinen masurischen Gottesdienst. Äußerlich ein wilder Bär, innerlich ein sanftes Lamm.
Die alte Skerra aus dem Armenhaus in Prinowen war der krasse Gegensatz von Przyborowski. Ihre Kleidung war sauber, ihr Antlitz voll Sonnenschein, ihre Augen strahlend von Glück und Zufriedenheit. Weder Frost noch Hitze, weder Sturm noch Regen konnte sie hindern, unser Gotteshaus zu besuchen. Sonntäglich wanderte das gekrümmte Mütterchen am Stabe, den weiten Weg von acht Kilometer zur Kirche, nahm teil am deutschen Gottesdienst und blieb zum polnischen, wenn ein solcher war, erinnernd an jene alte Hanna zu Jerusalem. Nur ein einziges Mal konnte sie nicht kommen: das war der Sonntag, an dem sie starb.
Den Platz des absterbenden Masurisch eroberte sich im Volk schnell das Plattdeutsch. Das Hochdeutsche konnte nicht Schritt halten. In der Schule freilich lernten die polnischen Kinder hochdeutsch sprechen, aber die Eltern und älteren Geschwister zogen den plattdeutschen Dialekt vor, den sie durch den Umgang mit plattdeutsch Redenden lernten. Das Plattdeutsch läuft viel glatter von der Zunge und verkürzt die Worte: z.B. Ons Vadder = unser Vater; ons ni Lehra = unser neue Lehrer. Es macht keinen Unterschied zwischen Dativ und Accusativ, liebt den Dativ “dem“ für beide Geschlechter und alle Kasus und setzt in zweifelnden Fällen, ob männlich oder weiblich, das sächliche Geschlecht: z. B. Öck häw dem Kau vom Unkel gekofft, dat Kau göft däglich tien Stop Melk. Dem Schmand schepp öck af on maak Botter. Dem Botter verköp öck for näge Dittke dat Pund on köp daför enen Dook för de Dochter.
Gefunden auf der HP angerburg.de